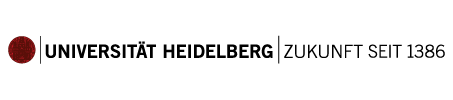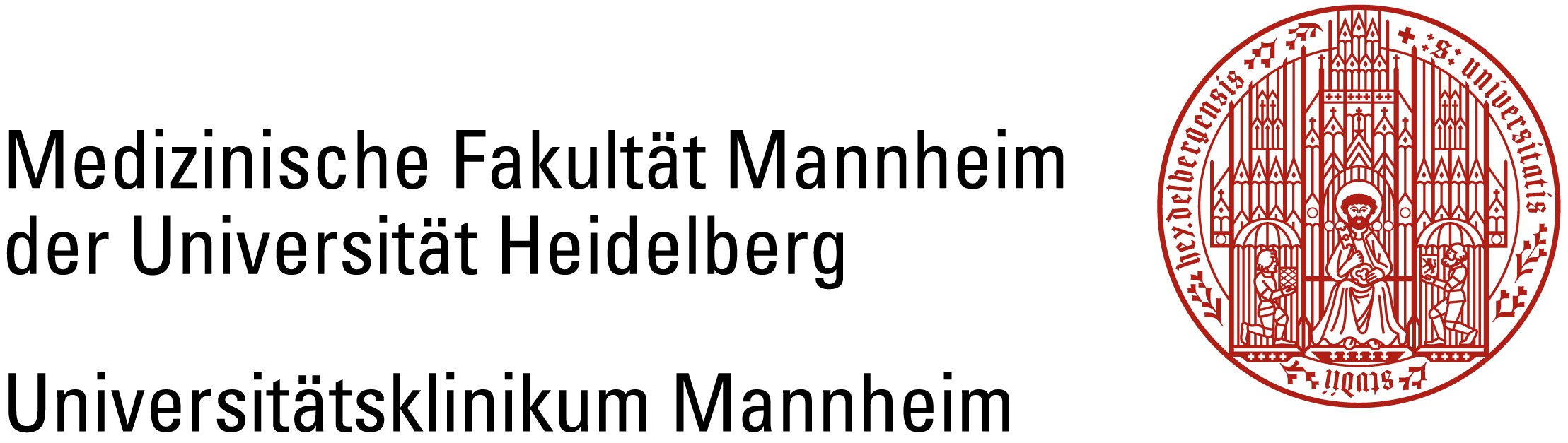Morbus Perthes
Direkt zum passenden Inhaltsbereich
Die genauen Ursachen für den Morbus Perthes sind bis heute nicht vollständig geklärt, jedoch werden verschiedene Faktoren diskutiert, die zur Entstehung dieser Erkrankung beitragen könnten. Im Zentrum der Überlegungen stehen Durchblutungsstörungen des Hüftkopfes, die möglicherweise durch Gefäßfehlbildungen oder andere Einflüsse bedingt sind. Auch hormonelle Dysregulationen und eine erhöhte Druckbelastung im Knochen oder Gelenkraum werden als mögliche Auslöser in Betracht gezogen. Genetische Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle, wobei eine multifaktorielle Vererbung vermutet wird; direkte Verwandte, insbesondere Geschwister, tragen ein erhöhtes Risiko. Interessanterweise wurden auch Zusammenhänge mit Gerinnungsstörungen, wie erhöhten Faktor-VIII-Werten und Faktor-V-Leiden-Mutationen, beobachtet. Umweltfaktoren, insbesondere ein niedrigerer sozioökonomischer Status, scheinen ebenfalls einen Einfluss zu haben. Auffällig ist zudem, dass bei Perthes-Patienten das Skelettalter oft bis zu drei Jahre jünger wirkt als das tatsächliche Alter. Einige Experten vermuten, dass wiederholte Mikrotraumen und eine erhöhte Belastung der Hüfte durch Hyperaktivität zur Entstehung beitragen könnten. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich wahrscheinlich um ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren handelt und nicht um eine einzelne Ursache.
Der Morbus Perthes ist eine komplexe Erkrankung des kindlichen Hüftgelenks, die einen charakteristischen Spontanverlauf aufweist. Die Erkrankung durchläuft typischerweise mehrere Stadien, wobei die Gesamtdauer vom Beginn bis zum Erreichen des Endzustandes mehrere Jahre betragen kann. Initial zeigt sich eine scheinbare Gelenkspaltverbreiterung im Hüftgelenk, gefolgt vom Kondensationsstadium, in dem eine Verdichtung der Knochensubstanz erkennbar wird. Im anschließenden Fragmentationsstadium kommt es zu einem scholligen Zerfall der Hüftkopfepiphyse, oft begleitet von einer Abflachung und möglichen Querverbreiterung des Hüftkopfes, der aus der Pfanne herausragen kann. Das Reparationsstadium ist durch eine allmähliche Wiederverknöcherung des Hüftkopfes gekennzeichnet, bevor im Ausheilungsstadium der Endzustand erreicht wird
Ohne Behandlung kann der Morbus Perthes zu einer bleibenden Verformung von Hüftkopf und Pfanne führen, was eine dauerhafte Bewegungseinschränkung und Beinverkürzung zur Folge haben kann. Ein frühzeitiger Verschleiß (Arthrose) des Hüftgelenks ist in solchen Fällen vorprogrammiert. Die Prognose hängt stark vom Alter bei Erkrankungsbeginn ab, wobei Kinder unter sechs Jahren tendenziell eine bessere Heilungsprognose haben. Trotz des oft langwierigen Verlaufs heilt der Morbus Perthes in der Regel aus, wobei das Ausmaß der Deformierung des Hüftkopfes im Endstadium variieren kann.
Diagnostik
Die Diagnostik des Morbus Perthes beginnt oft mit einer gründlichen klinischen Untersuchung, wenn Eltern bemerken, dass ihr Kind über Hüftschmerzen klagt oder beim Gehen humpelt. Typische Beschwerden sind Schmerzen in der Hüfte, Leiste oder im Knie sowie eine eingeschränkte Beweglichkeit des betroffenen Beins. Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, sind bildgebende Verfahren entscheidend. Ein Röntgenbild der Hüfte zeigt in der Regel charakteristische Veränderungen des Hüftkopfes, die auf Morbus Perthes hinweisen. In frühen Stadien, wenn die Röntgenveränderungen noch minimal sind, kann eine Magnetresonanztomographie (MRT) hilfreich sein, um die Durchblutungsstörung des Hüftkopfes genauer zu erkennen. In seltenen Fällen wird eine Ultraschalluntersuchung eingesetzt, um den Zustand des Hüftgelenks weiter zu beurteilen. Eine frühzeitige und genaue Diagnostik ist wichtig, um den Krankheitsverlauf zu überwachen und die passende Therapie zu planen.
Wichtig ist auch der Ausschluss von Differentialdiagnosen wie der Coxitis fugax oder juvenilen idiopathischen Arthritis, sollte der Verdacht bestehen, durch entsprechende klinische und laborchemische Untersuchungen.
Unser Behandlungskonzept
Die konservative Therapie des Morbus Perthes ist ein wichtiger Ansatz, um die Beweglichkeit des Hüftgelenks Ihres Kindes zu erhalten und eine Deformierung des Hüftkopfes zu vermeiden. Im Zentrum der Behandlung stehen regelmäßige Physiotherapie und Krankengymnastik, die darauf abzielen, die Beweglichkeit des Hüftgelenks zu verbessern, insbesondere bei der Abspreizung des Beines und der Drehung nach innen. Gleichzeitig empfehlen wir eine Reduktion der Belastung, indem anstrengende Aktivitäten vermieden und „Schritte gespart“ werden. Bei akuten Schmerzen oder Reizzuständen kann die vorübergehende Nutzung von Unterarmgehstützen oder eines Rollstuhls für längere Strecken sinnvoll sein. Eine dauerhafte Entlastung des Beines ist weder notwendig noch sinnvoll. Während viele Sportarten pausiert werden müssen, sind Schwimmen und Radfahren oft erlaubt und können sogar förderlich sein.
Ein wichtiger Bestandteil der Therapie sind regelmäßige Kontrollen: Alle drei Monate führen wir klinische Untersuchungen durch, um die Beweglichkeit zu überprüfen. Röntgenaufnahmen erfolgen anfangs viertel-, dann halbjährlich und später jährlich. Die Behandlung wird kontinuierlich an den Verlauf der Erkrankung und die individuellen Bedürfnisse Ihres Kindes angepasst. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Therapie des Morbus Perthes langwierig sein kann und sich über mehrere Jahre erstrecken kann. Ihre Unterstützung und Ermutigung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Unser Ziel ist es, Ihrem Kind trotz der Erkrankung eine möglichst normale Entwicklung zu ermöglichen. Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen oder bei Sorgen zur Verfügung und begleiten Sie und Ihr Kind durch den gesamten Behandlungsprozess.
Operative Therapie
Die operative Therapie des Morbus Perthes zielt darauf ab, den Hüftkopf besser in der Gelenkpfanne zu positionieren und somit eine optimale Heilung zu ermöglichen. Dies wird als „Containment“ bezeichnet. Folgende operative Verfahren kommen dabei häufig zum Einsatz:
- Varisationsosteotomie: Hierbei wird der Oberschenkelknochen hüftgelenksnah durchtrennt und der Winkel des Schenkelhalses korrigiert. Der Hüftkopf wird dadurch besser in der Pfanne eingestellt und mit einer stabilen Platte fixiert. Diese Technik ist besonders effektiv, wenn der Hüftkopf zur Seite hin deformiert ist.
- Beckenosteotomie: Bei diesem Eingriff wird die Hüftgelenkspfanne korrigiert, um den Hüftkopf besser zu überdachen. Je nach Alter des Kindes und Schweregrad der Erkrankung kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, wie die zum Beispiel die Beckendreifachosteotomie.
- Chirurgische Hüftluxation: In einigen Fällen kann es notwendig sein, das Hüftgelenk operativ auszurenken, um Deformitäten am Hüftkopf, Schenkelhals oder Trochanter major direkt zu korrigieren.
- Adduktorentenotomie: Hierbei werden verkürzte Hüftanspreiz-Muskeln verlängert, um die Hüftabspreizung zu verbessern.
Die Wahl der operativen Technik hängt vom individuellen Krankheitsverlauf, dem Alter des Kindes und den Ergebnissen der bildgebenden Diagnostik ab. Oft werden diese Verfahren auch kombiniert angewendet. Nach der Operation ist in der Regel eine Entlastungsphase von etwa sechs Wochen notwendig, gefolgt von intensiver Physiotherapie. Das zur Stabilisierung eingesetzte Metall wird meist nach etwa einem Jahr wieder entfernt.
Nachsorge
Unser Zentrum für Kinder- und Neuroorthopädie bietet eine spezialisierte Versorgung für Kinder mit Morbus Perthes. Mit unserem breiten Spektrum an konservativen und operativen Therapien, begleiten wir Patienten jeden Alters. Durch unser interdisziplinäres Team bieten wir eine kontinuierliche Betreuung an, die individuell auf die veränderten Bedürfnisse in jedem Lebensabschnitt angepasst ist.